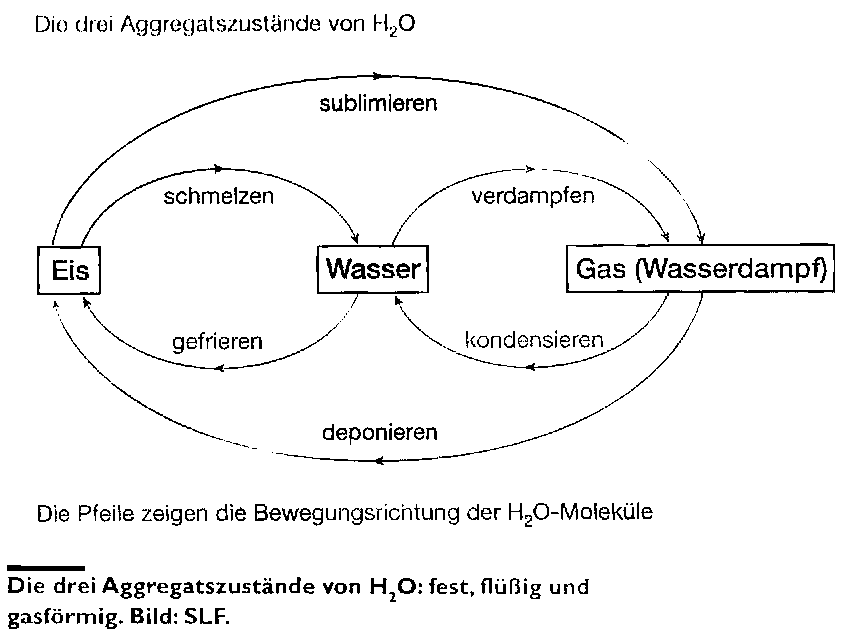
1.) Zusammensetzung (+ Einleitung)
2.) Zirkulation
3.) Dichte
4.) Schneearten
5.) Metamorphose
ad 1
Die unterschiedliche Zusammensetzung und
die Menge des Schnees gibt Auskunft über die aktuelle Lawinengefahr.
Die Lawinenforschung befasst sich schon seit mehr als 60 Jahren mit der
unterschiedlichen Zusammensetzung und den unterschiedlichen Schneearten.
Es ist der Hauptteil der Forschungsarbeit, der aus der Analyse und der
Auswertung der Schneeproben besteht.
Schnee besteht aus H2O. Je nach Konsistenz
kann der Schnee mehr (Neuschnee 90%) oder weniger (Altschnee 70%) Luft
enthalten.
Der Anteil der Luft bestimmt auch die
Masse. Je mehr Neuschnee desto leichter ist der Schnee. Je mehr Altschnee
desto schwerer ist der Schnee. (Dichte à 3)
Die gesamte Masse resultiert aus unterschiedlich
zusammengesetzten Schneeflocken. Diese sind ein Resultat winziger Schneekristalle,
die sich miteinander verketten. Der symmetrische, kantige Aufbau einer
Schneeflocke(ein Gewirr von Schneekristallen), inspirierte schon vor Jahrhunderten
namhafte Mathematiker wie Johannes Kepler, René Descartes und Robert
Hooke. Diese durchläuft auf ihrem Weg zum Boden unterschiedliche Temperaturstadien.
Die Temperatur beeinflusst auch die Zusammensetzung.
Die Schneeablagerungen haben unterschiedliche
Schichten (Schneearten à 4). Die Zusammensetzung ändert sich
sobald die Schneeflocke den Boden erreicht hat. Durch das „Gewicht“ wird
der Schnee zusammengepresst (Kräfte- und Spannungsverhalten à
6). Er wird dann härter und seine Oberfläche glatter. Dies betrifft
die unteren Schichten die sich durch zunehmende Kompression und Kälte
zu einer harten Platte entwickeln können. Diese an der Erde und den
Steinen haftende Schicht ist eine Startbasis für Lawinen. Der Neuschnee
kann an einer solchen Schicht nicht mehr haften und bildet eine eigene
Schicht, die durch Erwärmung dichter wird. Es entsteht so eine schwere
rutschige Schicht, die auf einer glatten harten Platte lagert. Wenige Impulse
genügen nun um die tonnenschweren Schneemassen abrutschen zu lassen.
ad 2
Die Zirkulation des Schnee ist der Kreislauf
des Wassers. Es geht hierbei besonders um den Wechsel des Aggregatszustandes
des Wassers unter und über null Grad.
Eis (ein Feststoff) wird durch langsame
Erwärmung zum Schmelzen gebracht und es entsteht Wasser (eine Flüssigkeit).
Durch weitere Erhitzung entsteht Wasserdampf (gasförmig). Dieser Kreislauf
ist den meisten Leuten bekannt und auch bildlich vorstellbar. Unbekannter
ist allerdings die Sublimation und die Deposition. Durch starke Kühlung
(z.B.: durch Wind mit weit unter 0°C) wird Wasserdampf direkt in Eis
verwandelt (Deposition). Es bildet sich Reif, der durch sich überlagernde
Wassertropfen des Windes entsteht. Die Ablagerung „wächst“ also dem
Wind entgegen. Bei der Sublimation wird durch intensive heiße Lichteinstrahlung
und den passenden Wetterbedingungen Eis in Wasserdampf umgewandelt. (Gegenteil
zu Deposition)
Bild:
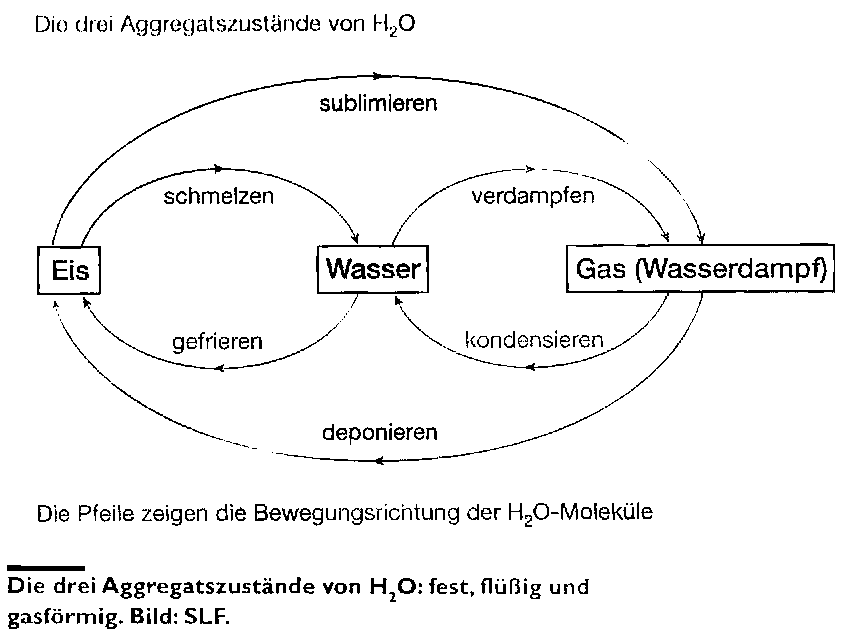
ad 3
Die Dichte ist ein wichtiges Merkmal des
Schnees. Zur Einteilung des Schnees in unterschiedliche Arten (Schneearten
à 4) bedient man sich der unterschiedlichen Dichte der Schneeschichten.
Die Dichte ist ein klares durch Formel errechenbares Unterschiedungsmerkmal,
das einen fixen Punkt in der Schneeanalyse darstellt. Die allgemeine Formel
ist: s=m/V („Dichte des Schees ist gleich Masse der Schneeprobe
durch das Volumen der Schneeprobe)
Die Dichte ist immer kleiner als 1 (kleiner
als Wasser), da der Schnee aus viel Luft besteht. Je mehr Masse und weniger
Volumen desto mehr Dichte(„Kompression“).
ad 4
Die Dichte bestimmt auch die Schneeart.
Die Inuits haben für Schnee rund 200 verschiedene Begriffe. Sie können
also Schnee viel genauer beschreiben und bezeichnen als wir. Deshalb haben
Experten im deutschen Sprachraum einige verschiedene klar definierte Begriffe
für Schnee. Die Bezeichnungen richten sich nach der Dichte (in kg/m³)
und den Porenanteil (in %).
| Schneeart | Dichte | Porenanteil n % |
| Neuschnee | ||
| im Mittel | 100 | 89 |
| Wildschnee (sehr selten) | 10 - 30 | 99 - 97 |
| Pulverschnee (locker, trocken) | 30 - 60 | 97 - 93 |
| schwach windgepackt | 60 - 100 | 93 - 89 |
| stark windgepackt | 100 - 300 | 89 - 67 |
| feucht (Pappschnee) | 100 - 200 | 89 - 78 |
| Filziger Schnee | 150 - 300 | 84 - 67 |
| Rundkörniger Altschnee | ||
| im Mittel | 350 | 62 |
| trocken, gesetzt | 200 - 450 | 78 - 51 |
| Kantig-körniger Schnee | 250 - 400 | 73 - 56 |
| Schwimmschnee | 150 - 350 | 84 - 62 |
| Naßschnee | 300 - 600 | 67 - 35 |
| nasser Firnschnee | 600 - 800 | 35 - 13 |
| Gletscher-Eis | 800 - 900 | 13 - 2 |
| Eis, porenfrei | 917 | 0 |
| Wasser | 1000 | 0 |
| Lawinenschnee, abgelagert | 500 - 800 | 45 - 13 |
ad 5
Der Schnee ist zu keiner Zeit gleichbleibend.
Er verändert sich laufend. In seiner "Flugphase" und in der "Bodenphase"
ändern sich die Temperatur, die Dichte und die Form der Kristalle.
Wenn der Schnee am Boden liegt, dann befindet er sich in einem Kreislauf.
Nicht nur der Kreislauf der Zirkulation (Zirkulation à 2), sondern
auch die sogenannte Metamorphose zeigen ihre Wirkung. In der Schneedecke
bewegen sich die Wassermoleküle ständig von wärmeren zu
kälteren Bereichen. Die Temperaturverlagerung ändert sich mit
der Tageszeit und der Sonneneinstrahlung. Die Schneekristalle ändern
sich. Diesen Umwandlungsprozess nennt man Metamorphose. Es gibt die aufbauende
und die abbauende Metamorphose. Die Metamorphose ist ein komplizierter,
komplexer Vorgang.
Eine vereinfachte, kurze Beschreibung:
Bei der aufbauenden Metamorphose zum Beispiel
wandelt sich der rundkörnige Altschnee (Schneearten à 4) zu
Schwimmschnee um. Die Geschwindigkeit der aufbauenden Metamorphose hängt
vom Temperaturgefälle ab. Bei tiefen Außentemperaturen und einer
dünnen Schneedecke bilden sich schnell becherartige Hohlformen (sogenannte
Becherkristalle). Mit steigender Luftzirkulation bildet sich schneller
als sonst eine unstabile Unterlage (Schwimmschnee).
Bei der abbauenden Metamorphose wandelt
sich Neuschnee zu körnigem Altschnee um. So beginnen sich die Schneeflocken
zu verändern, wenn sie den Boden erreicht haben. Es bildet sich vorübergehend
Filzschnee. Die Schneedecke wird in Folge stabiler und fester. Bis zur
vollständigen Setzung des Neuschnees dauert es 1 - 3 Tage.